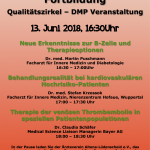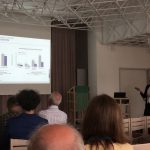Archiv der Kategorie: Aktuelles aus der Berufspolitik
Mengensteigerung bei Knie-OPs: „Weckruf“ für die Gesundheitspolitik
Mengensteigerung bei Knie-OPs: „Weckruf“ für die Gesundheitspolitik
Bertelsmann-Studie vom 19.06.2018
Berlin, 20.06.2018: In der am 19. Juni 2018 von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten Studie unter dem Titel „Knieprothesen – starker Anstieg und große regionale Unterscheide“ werfen die Autoren die Frage auf: „Wird vorschnell operiert?“ Dazu beziehen die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU), die Deutsche Gesellschaft für Endoprothetik (AE), die Deutsche Kniegesellschaft (DKG) und der Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) wie folgt Stellung: Der Anstieg für den Ersatz eines künstlichen Kniegelenkes seit 2009 liegt mit acht Prozent im internationalen Durchschnitt. Die Fachgesellschaften erwarten aufgrund des demografischen Wandels jedoch noch höhere Zahlen: Denn Deutschland befindet sich beim Altersdurchschnitt der Bevölkerung weltweit in einer Spitzengruppe. Daher verstärken die Fachgesellschaften DGOU, AE, DKG und BVOU seit Jahren ihre Maßnahmen im Bereich der Kniegelenkerkrankungen – sowohl für die qualitätsgesicherte chirurgische Versorgung durch die Initiative EndoCert® zur Zertifizierung von endoprothetischen Versorgungszentren als auch für gelenkerhaltende Behandlungsmaßnahmen. „Diese Strategie kann aber nur dann noch erfolgreicher sein, wenn die Qualität und konservative Behandlung zukünftig wieder besser vergütet werden“, sagt Professor Dr. Carsten Perka, DGOU-Vizepräsident und AE-Präsidiumsmitglied.
Im Interview sprechen DGOU-Experte Professor Dr. Klaus-Peter Günther und BVOU-Präsident Dr. Johannes Flechtenmacher über die Gründe der Mengensteigerung bei Knie-Operationen, regionale Unterschiede, Maßnahmen der Fachgesellschaften und des Berufsverbandes und die Studie, die sie auch als Weckruf an die Gesundheitspolitik verstehen.
Wie werten Sie die Studie der Bertelsmann-Stiftung?
Günther: Der erschienene Bertelsmann-Report zur Entwicklung der Knie-Endoprothetik in Deutschland wird in weiten Teilen von den Fachgesellschaften unterstützt. Leider weisen die Autoren nicht darauf hin, dass das Verfahren der regionalen Bestimmung von Operationsraten in der Endoprothetik bereits vor Jahren mit Unterstützung der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie(DGOOC) und des AOK-Bundesverbands etabliert wurde. Damals schon wiesen diese Institutionen auf eine auffällige Ungleichverteilung von Operationsraten in den einzelnen Bundesländern hin. Vor allem die Fachgesellschaften haben seither eine Reihe von Maßnahmen entwickelt, die eine patientengerechte operative Versorgung unterstützen.
Welche Gründe gibt es für die Mengenentwicklung aus Sicht der Fachgesellschaften?
Günther: Betrachtet man den Anstieg der Endoprothesenzahlen nicht nur in den letzten drei Jahren, sondern – wie im Bericht der Bertelsmann-Stiftung eigentlich dargestellt – im Gesamtverlauf seit 2009, fällt die Steigerungsrate deutlich moderater aus und liegt mit etwa acht Prozent im internationalen Durchschnitt. Die wichtigste Ursache dafür ist der demografische Wandel. Hier würden eigentlich noch höhere Zahlen zu erwarten sein, denn Deutschland liegt im Altersdurchschnitt der Bevölkerung weltweit in einer Spitzengruppe.
Vor allem aber sind die Ergebnisse in der Knie-Endoprothetik in den letzten Jahren nochmals deutlich verbessert worden, wovon nicht nur ältere, sondern auch jüngere Patienten mit hohem Leistungsanspruch profitieren. Die besseren Ergebnisse führen auch zu einer verstärkten Nachfrage nach dieser Versorgung auch in dieser Altersgruppe, verbunden mit dem Ziel, wieder voll funktionstüchtig zu werden. Konservative Maßnahmen wie Physiotherapie, medikamentöse Therapie und Injektionen können dies in dieser Altersgruppe meist nicht im gewünschten Umfang leisten.
Welche Gründe gibt es für die Mengensteigerung, die im Vergütungssystem begründet liegen?
Günther: Der Bericht weist zu Recht auf wichtige Faktoren hin, die in der Mengenentwicklung von künstlichen Kniegelenken eine zentrale Rolle spielen. Dazu gehört in erster Linie das im Gegensatz zu anderen Ländern exzessiv betriebene Refinanzierungssystem mit DRG-Fallpauschalen. Seit Jahren wird die alternative konservative Behandlung unzureichend vergütet. Wenn ärztliche Beratung und konservative Maßnahmen nicht angemessen honoriert werden, ist die frühere Entscheidung zum Kunstgelenkersatz keine Überraschung. Auch ist nach wie vor die Zahl der Einrichtungen, in denen der Kniegelenkersatz angeboten wird, zu groß.
Flechtenmacher: Eine konservative Behandlung zur Abwendung einer Operation braucht Zeit. Patienten mit Arthrose muss man intensiv beraten: Wie wichtig ist es abzunehmen? Welche Begleiterkrankungen sind zu beachten, bevor man Schmerzmittel empfiehlt? Warum ist Bewegung wichtig? Die Zeit dafür fehlt in den stark frequentierten Praxen, sie wird auch nicht vergütet. Und die Budgets erlauben es nicht, so engmaschig wie manchmal nötig Krankengymnastik zu verordnen.
Geht es auch anders, zum Beispiel mit einer intensivierten konservativen Therapie?
Flechtenmacher: Das funktioniert aktuell leider vor allem in Selektivverträgen. Darüber kann dann beispielsweise eine Option „Alternative konservative Behandlung bei drohenden Operationen“ angeboten und finanziert werden. Ein gutes Beispiel ist der gemeinsam von BVOU und der Deutschen Arzt AG verhandelte Selektivvertrag für Versicherte von DAK, Barmer und einigen Betriebskrankenkassen. Bei diesem Modell arbeiten Orthopäden und Physiotherapeuten eng mit dem Patienten zusammen, um unter anderem durch eine hohe Frequenz an Krankengymnastik und eventuell einem Gerätetraining eine Operation hinauszuzögern oder zu vermeiden. So schöpfen Patienten oft erst wieder Hoffnung, mit ihren Beschwerden und Schmerzen gut leben zu können – auch ohne eine Operation. Aber selbst die Patienten, bei denen eine Operation unumgänglich ist, profitieren von dem Angebot. Sie werden intensiv darauf vorbereitet und sind nach der OP rascher wieder mobil.
Auch der erfolgreiche Orthopädie-Facharztvertrag von AOK Baden-Württemberg, MEDI und dem BVOU ist ein gutes Bespiel für eine strukturierte und intensivierte ambulante Betreuung mit dem Fokus auf einer leitlinienorientierten konservativen Therapie bei Knie- und Hüftarthrosepatienten. Leider sind das bisher zu wenige regionale Leuchtturm-Ansätze. Die Schlussfolgerungen der Bertelsmann-Stiftung zeigen aber, wie notwendig die Implementierung und Finanzierung konservativer Therapiekonzepte ist. Das sollte als Appell an die Kostenträger verstanden werden.
Muss die Gesundheitspolitik an dieser Stelle wirksamer werden?
Flechtenmacher: Hochwertige Medizin ist sowohl in der konservativen Therapie als auch in der Endoprothetik nicht zum Billigtarif zu haben. Im Vergleich zu den von den Fachgesellschaften und vom Berufsverband bereits eingeleiteten Maßnahmen bleiben die Steuerungsmöglichkeiten der Gesundheitspolitik aktuell noch deutlich zurück – zum Beispiel hinsichtlich Qualitätsverträgen und Zentrumszuschlägen. Die umfassenden Möglichkeiten der ambulanten konservativen Therapie werden derzeit vom GKV-System nur über Selektivverträge vergütet und stehen damit weder flächendeckend noch für alle Versicherten gleichermaßen zur Verfügung.
Günther: Die jetzt beobachtete Mengensteigerung muss auch als starker Weckruf an die Gesundheitspolitik verstanden werden. Die Fachgesellschaften arbeiten seit Jahren an qualitätsfördernden Maßnahmen im Bereich der Endoprothetik. Dazu gehört in erster Linie die EndoCert-Initiative der DGOOC gemeinsam mit der AE und dem BVOU. Dort werden hohe Qualitätsstandards gefordert – insbesondere auch für die Indikationsstellung. Aktuell wird in allen EndoCert-Kliniken und darüber hinaus die ebenfalls mit Unterstützung von DGOOC und AE erstellte AWMF-Leitlinie für die Entscheidung zum Kunstgelenkersatz eingeführt. Diese Initiative soll sicherstellen, dass durch eine ausführliche ärztliche Beratung die Entscheidung zur Operation nicht zu früh getroffen wird und zuvor eine angemessene konservative Behandlung erfolgt ist.
Gleiches gilt für den Mehraufwand, den zertifizierte Kliniken in der Patientenfürsorge betreiben. Seit Jahren verstärken Fachgesellschaften wie die AE und die DKG gerade im Bereich der Kniegelenkerkrankungen die Schulung in gelenkerhaltenden Behandlungsmaßnahmen. Sollte nach allen ausgeschöpften gelenkerhaltenden Maßnahmen dann aber das Kunstgelenk notwendig werden, muss sichergestellt sein, dass die Behandlung in Einrichtungen mit ausreichend hohen Fallzahlen und geprüften Behandlungsstandards erfolgt. Beides sind entscheidende Voraussetzungen für den Behandlungserfolg, wie mittlerweile nicht nur international, sondern auch an deutschen Daten nachgewiesen werden konnte: im EndoCert-Verfahren wie auch dem von der DGOOC etablierten Deutschen Prothesenregister EPRD.
Hier ist zu wünschen, dass einige der im Bertelsmann-Bericht gezogenen Schlussfolgerungen auch gehört werden.
Zu den Personen:
Professor Dr. Carsten Perka ist Ärztlicher Direktor des Centrums für Muskuloskeletale Chirurgie, Charité – Universitätsmedizin Berlin.
Dr. Johannes Flechtenmacher ist niedergelassener Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Ortho-Zentrum in Karlsruhe.
Professor Dr. Klaus-Peter Günther ist Geschäftsführender Direktor des Universitätscentrums für Orthopädie & Unfallchirurgie, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden.
Er hat als Mitautor an der 2013 erschienenen Publikation „Knieoperationen – Regionale Unterschiede und ihre Einflussfaktoren“ aus der Reihe Faktencheck Gesundheit der Bertelsmann-Stiftung mitgearbeitet.
Gesucht: Assistenzärztinnen und Assistenzärzte
Gesucht: Assistenzärztinnen und Assistenzärzte
Pressemitteilung: Hautschutz von Kindheit an
Informationsveranstaltung zum Thema Hautkrebsprävention im Kindergarten
Hautschutz von Kindheit an
Lüdenscheid – 12.07.18
Es ist im Sommer schnell passiert – Kinder spielen bei schönem Wetter stundenlang im Freien und kommen am Abend mit einem Sonnenbrand nach Hause. Dies ist besonders gefährlich, da Sonnenbrände in der Kindheit einen wesentlichen Risikofaktor für Hautkrebs darstellen. Worauf Erzieher und Eltern achten sollten, damit die Kleinen nicht zu viel Sonne erwischen, erklärte am vergangenen Dienstag Max Tischler, Assistenzarzt der Hautklinik am Klinikum Lüdenscheid. Der Vortrag zum Thema „Aktiv vorbeugen vor Hautkrebs: schützt Eure Kinder!“ fand im Rahmen der „EuroMelanoma Kampagne 2018“ statt, die unter der Schirmherrschaft der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft und des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen steht.
19 Erzieherinnen und Erzieher heimischer Kindergärten, die für über 800 Kinder in Lüdenscheid und Umgebung verantwortlich sind, folgten der Einladung zum Vortrag und erhielten neben einem Überblick zum Thema UV-Strahlung und Hautkrebs viele praktische Tipps zum richtigen Hautschutz bei Kindern. So erfuhren die Teilnehmer, dass die benötigte Menge an Sonnencreme oft zu gering eingeschätzt wird. Als Faustregel empfahl Referent Max Tischler vier Esslöffel Sonnencreme pro Anwendung. Diese muss selbstverständlich gleichmäßig auf allen Stellen des Körpers aufgetragen werden. „Gerade die Oberseiten der Hände und der Rücken sind Stellen, die oft vergessen werden“, weiß der Experte der Hautklinik.
Auch sollten Kinder am besten bereits 30 Minuten, bevor Sie in die Sonne gehen, eingecremt werden. Neben dem gründlichen Eincremen ist zudem auch ein textiler Sonnenschutz wichtig. Hüte mit einer großen Krempe bieten zum Beispiel Schutz für die Ohren, den Nacken und die Schultern der Kinder.
Am Ende des Vortrags gab es noch genügend Zeit für die Fragen der Gäste. Diese interessierte zum Beispiel, wie lange die Wirkung von Sonnencreme vorhält.  Ist Sonnenschutz-Spray so wirksam wie Sonnencreme? Und welche unterschiedlichen Wirkungsweisen haben Cremes und Sprays? Dr. Dorothee Dill, Direktorin der Hautklinik am Klinikum Lüdenscheid und Max Tischler freuten sich über das große Interesse der Besucher und sehen die Aufklärungsarbeit als wichtigen Schritt im Kampf gegen Hautkrebs an:
Ist Sonnenschutz-Spray so wirksam wie Sonnencreme? Und welche unterschiedlichen Wirkungsweisen haben Cremes und Sprays? Dr. Dorothee Dill, Direktorin der Hautklinik am Klinikum Lüdenscheid und Max Tischler freuten sich über das große Interesse der Besucher und sehen die Aufklärungsarbeit als wichtigen Schritt im Kampf gegen Hautkrebs an:
„Es reicht bereits aus, ein paar Dinge zu beachten, um das Hautkrebsrisiko beträchtlich zu senken“, so Dr. Dill.
Wolfram: Faires Auswahlverfahren für alle Bewerber nach Wegfall der Wartezeitquote wichtig!
Wolfram: Faires Auswahlverfahren für alle Bewerber nach Wegfall der Wartezeitquote wichtig!
Die Medizinstudierenden im Hartmannbund begrüßen mit dem KMK-Beschluss den Beginn des Reformprozesses zum Auswahlverfahren: „Schön, dass nun erste Schritte hin zu einem gerechteren Auswahlverfahren gegangen werden“, so Christian Wolfram, Vorsitzender des Ausschusses der Medizinstudierenden im Hartmannbund.
„Nach dem Wegfall der Wartezeitquote ist es nun wichtig, neue gerechte Qualifikationsmöglichkeiten zu eröffnen, die auch Studienanwärtern mit einem schlechteren Notenschnitt den Zugang zum Medizinstudium ermöglichen“, so Wolfram.
„Ein bundesweit einheitliches Zulassungsmodell, bei dem die Abiturnote lediglich mit einem Drittel gewertet wird, ist hier der richtige Weg,“ erläutert Wolfram das Modell des Hartmannbundes. Dieses Modell sieht neben der Abiturnote einen standardisierten schriftlichen Test und ein Assessmentverfahren als weitere gleichrangige Komponenten vor. 20 Prozent der zu vergebenden Studienplätze sollen zudem durch individuelle Auswahlverfahren der Universitäten besetzt werden können, um entsprechende Schwerpunktsetzungen der Hochschulen zu ermöglichen.
Schwangerschaftsabbruch: Werbeverbot beibehalten, Beratungs- und Hilfsangebote stärken
Schwangerschaftsabbruch: Werbeverbot beibehalten, Beratungs- und Hilfsangebote stärken
Erfurt, 12.05.2018 – Der 121. Deutsche Ärztetag 2018 hat eine Stärkung der neutralen Information, der individuellen Beratung und der Hilfeleistung für Frauen in Konfliktsituationen gefordert. Ärztinnen und Ärzte in Praxen und Kliniken benötigten Rahmenbedingungen, die es ihnen ermöglichen, sich Zeit für die individuelle Beratung ratsuchender Frauen zu nehmen, heißt es in der mit der großer Mehrheit angenommen Entschließung. Darüber hinaus seien die in Deutschland entwickelten Strukturen mit qualifizierten Beratungsstellen und Hilfsangeboten weiter zu fördern und wo erforderlich auszubauen. Der Entscheidung der Frau über den Abbruch müsse eine ergebnisoffene und unabhängige Beratung vorausgehen, die von geeigneten Hilfsangeboten begleitet werde, so der Ärztetag.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stellt im Internet umfangreiche Informationen zum Thema Schwangerschaftskonflikt und Schwangerschaftsabbruch bereit und vermittelt über eine Datenbank mit regionaler Suchfunktion zu den anerkannten Beratungsstellen. Diese Angebote seien kontinuierlich weiterzuentwickeln und noch stärker bekannt zu machen, forderten die Abgeordneten.
Die anerkannten Beratungsstellen seien zu verpflichten, jede Frau, die sich nach der ergebnisoffenen Beratung für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, auch darüber zu informieren, welche Ärztinnen und Ärzte in erreichbarer Nähe Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Dazu gehöre auch die Erläuterung, mit welchen Verfahren der Schwangerschaftsabbruch bei diesen Ärztinnen und Ärzten erfolgen kann.
Der Ärztetag wies darauf hin, dass der Entscheidung der Frau über den Abbruch die gesetzlich vorgeschriebene, ergebnisoffene und neutrale Beratung durch eine anerkannte Beratungsstelle vorausgehen muss. Dazu sei im Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) vorzugeben, dass einer Frau, die sich nach der Beratung für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, eine Auflistung der für sie erreichbaren Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung gestellt wird, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen.
Gemäß § 5 des SchKG haben die Länder ein ausreichendes plurales Angebot wohnortnaher Beratungsstellen sicherzustellen. Die flächendeckende Bereitstellung qualifizierter Beratungs-, aber auch Hilfsangebote für Frauen in Schwangerschaftskonfliktsituationen sei Kennzeichen einer humanen Gesellschaft, so der Ärztetag. Dazu gehöre eine gute personelle wie finanzielle Ausstattung dieser Angebote.
Der Deutsche Ärztetag hat sich gegen eine Streichung oder Einschränkung des in § 219a kodifizierten Werbeverbotes für Abtreibungen ausgesprochen, mahnt aber maßvolle Änderungen an, damit sichergestellt wird, dass Ärztinnen und Ärzte, die innerhalb dieses Rahmens über ihre Bereitschaft informieren, gesetzlich zulässige Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen, nicht bestraft werden.
Bei allen Überlegungen zu Änderungen an den gesetzlichen Vorgaben zum Schwangerschaftsabbruch, auch zum Werbeverbot nach § 219a StGB, muss der besondere Charakter des Schwangerschaftsabbruches berücksichtigt werden.
Zeitungsartikel 21.06.2018
Zeitungsartikel 21.06.2018 in den Lüdenscheider Nachrichten

Anschluss an die TI: Finanzierung ohne Wenn und Aber
Anschluss an die TI: Finanzierung ohne Wenn und Aber
„Wir unterstützen die Kassenärztliche Bundesvereinigung hinsichtlich der aktuellen Forderung nach vollständiger Finanzierung der Anbindung von Praxen an die Telematikinfrastruktur. Wir fordern die gesetzlichen Krankenkassen auf, wie im Gesetz vorgesehen, die dafür entstehenden Kosten – ohne Wenn und Aber – zu übernehmen!“, so Dr. Dirk Heinrich, Vorstandsvorsitzender des SpiFa.
Niedergelassene Ärzte müssen eine Anbindung ihrer Praxen an die TI nicht selbst finanzieren. So sieht es jedenfalls die gesetzliche Vorgabe aus dem E-Health-Gesetz vor, wonach die gesetzlichen Krankenkassen verpflichtet sind, die Kosten für den Anschluss der Praxen zu übernehmen. Dass die Industrie derzeit nicht in der Lage ist, entsprechend ausreichend Praxen anzubinden, liegt nicht in der Verantwortung der niedergelassenen Ärzte oder der ärztlichen Selbstverwaltung. Dennoch auf einer sukzessiven Absenkung der Finanzierungspauschalen für die Anbindung an die Telematikinfrastruktur zu bestehen, kann nur als Blockadehaltung des GKV-Spitzenverbandes verstanden werden.
„Welchen Wert hat eine gemeinsame Selbstverwaltung, wenn der eine Verhandlungspartner die Mitglieder des Anderen so im Regen stehen lässt?“, ergänzt Dr. Axel Schroeder, Vorstandsmitglied des SpiFa zur mangelnden Bereitschaft einer vollständigen Finanzierung des Anschlusses an die Telematikinfrastruktur durch die Krankenkassen.
Veranstaltung 06/2018 und Mitgliederversammlung 2018
Veranstaltung 06/2018 und Mitgliederversammlung 2018
Die Veranstaltung des Ärztevereins Altena-Lüdenscheid e.V. im Juni 2018 wurde erneut als DMP-Veranstaltung ausgetragen. Erschienen waren ca. 20 interessierte Ärztinnen und Ärzte, die den Vortragenden aufmerksam zuhörten.
Anschließend fand die Mitgliederversammlung des Ärztevereins statt, in welcher der „alte“ Vorstand in seinem Amt bestätigt wurde.
Im Anhang finden Sie die entsprechende Pressemitteilung:
Stärkung der Ärzte im Märkischen Kreis: Vorstand des Ärztevereins Altena-Lüdenscheid einstimmig wiedergewählt
Durch Integration, Kooperation und Nachwuchsarbeit erfolgreich die Weichen für die Verbesserung der Versorgung von Patienten im Märkischen Kreis für die Zukunft gestellt.
Anlässlich der Jahreshauptversammlung des Ärztevereins Altena Lüdenscheid am Abend des 13.06.2018 wurde der Vorstand mit Herrn Dr. Gerhard Hildenbrand als erstem Vorsitzenden, Frau Dr. Dorothee Dill als stellvertretende Vorsitzende, Prof. Dr. Bernd Lemke als stellvertretender Vorsitzender, Prof. Dr. Markus Zarse als Schriftführer und Herr Max Tischler als Kassenwart einstimmig wiedergewählt. Herr Dr. Hildenbrand erläuterte das erfolgreiche Konzept der letzten Jahre, welches es dem Ärzteverein ermöglicht hat durch hochwertige Fortbildungen aber auch kulturelle Aktivitäten als Brückenbauer zwischen den in Praxis und Klinik tätigen ärztlichen Kollegen und ihren verschiedenen arbeitsweltlichen Hintergründen zu fungieren. Durch gute Kooperationen mit anderen Ärztenetzen wie dem Lennetz und dem Ärztenetz MK-Süd sollen künftig vermehrt auch Ärzte außerhalb von Lüdenscheid und Altena eingebunden werden. Ein besonderes Augenmerk legt der Ärzteverein auf die Einbindung junger ärztlicher Kolleginnen und Kollegen, welches dem Kassenwart, Herrn Max Tischler durch die Etablierung eines Assistentenstammtisches gelungen ist. Frau Dill betonte, dass der Ärzteverein sich vermehrt auch in der Patientenfortbildung engagieren wird und somit auch die Gesundheitsbildung von Bürgerinnen und Bürgern im Märkischen Kreis verbessert werden soll. Dies hilft letztendlich jedem Einzelnen. Auch politisch zeigt der Ärzteverein Flagge: Die Wanderausstellung „Im Gedenken der Kinder, zum Schicksal von Kindern unter dem NS Regime, welche in Lüdenscheid in der Zeit vom 29.10.-07.12. zu sehen ist, findet in Kooperation mit dem Ärzteverein statt.